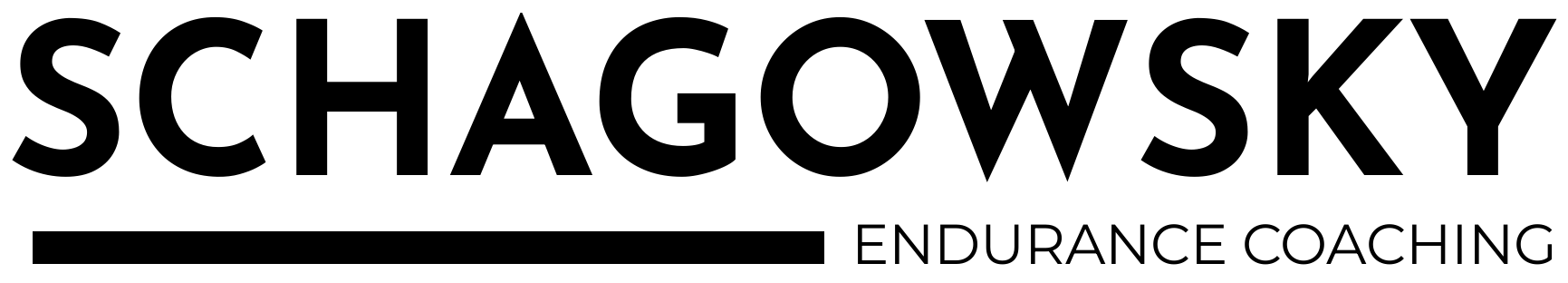Subjektive Belastung im Ausdauersport
Wahrnehmung, Einflussfaktoren und praktische Anwendung
Welche Arten des Belastungsempfinden gibt es?
Das Belastungsempfinden wird in ein objektives und ein subjektives Belastungsempfinden unterschieden.
Das Objektive Belastungsempfinden bezieht sich auf messbare Faktoren, wie die Herzfrequenz, Leistung, Atmung, Pace oder Trittfrequenz aber auch die zurück gelegte Distanz oder ins Training investierte Zeit.
Das subjektive Belastungsempfinden wiederum blendet all diese klaren Parameter aus und bezieht sich ausschließlich auf die persönliche Einschätzung der Anstrengung des Athleten.
Je nach Athleten kann das persönliche Belastungsempfinden ein erstaunlich präzises Werkzeug sein, um das Training zu steuern, Fortschritte zu erkennen und Überlastung zu vermeiden.
Wie wird das subjektive Belastungsempfinden erfasst?
Das subjektive Belastungsempfinden wird typischer weise mithilfe von standardisierten Skalen erfasst. Am bekanntesten ist die Borg-RPE-Skala („Rate of Preceived Exertion“)
Diese geht klassisch von 6 bis 20, wobei 6 als „sehr, sehr leicht“ und 20 als „maximale Anstrengung“ gilt.
Die Zahlen dieser Skala wurden ursprünglich so gewählt, dass sie mit der Herzfrequenz korrelieren (z.B. RPE 13 ≈ 130 bpm)
Alternativ zur Borg Skala wird häufig auch die CR10-Skala verwendet. Diese reicht von 0 („keine Anstrengung“) bis 10 („maximale Anstrengung“).
Wann wird das subjektive Belastungsempfinden festgelegt?
Das Festlegen des subjektiven Belastungsempfinden kann zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen.
So kann direkt nach der Durchführung einzelner Intervalle eines Trainings die Einstufung in der verwendeten Skala erfolgen und das gesamte Training so in mehrere Einstufungen unterteilt werden oder auch das gesamte Training mit einer einzelnen Einstufung bewertet werden.
Beide Vorgehensweisen haben ihre Vor- und Nachteile in der nachfolgenden Trainingsauswertung.
RPE vs. Leistungsdiagnostik – Ersatz oder Ergänzung?
Eine gut durchgeführte Leistungsdiagnostik liefert objektive Daten zu Schwellen, Zonen und physiologischen Kenngrößen. Sie kann dabei sehr Präzise sein.
Jedoch..
- .. ist sie dabei punktuell und nicht täglich verfügbar.
- .. misst sie dabei unter Laborbedingungen und nicht unter Alltäglichen Gegebenheiten.
- .. ist sie mit höheren Kosten verbunden.
Athleten, die regelmäßig mit RPE arbeiten, entwickeln ein feines Gespür für Intensitäten.
Viele von ihnen können ihre anaerobe Schwelle erstaunlich genau einschätzen und dies ganz ohne Labordiagnostik.
Wo liegen die Grenzen des subjektiven Belastungsempfinden?
Das natürliche Belastungsempfinden ist leider kein perfektes System für die tägliche Trainingssteuerung. Es ist stark beeinflussbar durch die Stimmung, das Selbstbild, den Gruppendruck oder von mangelnder Erfahrung. Besonders bei Einsteigern kann die eigene Einschätzung noch stark schwanken.
Auch ist das subjektive Belastungsempfinden durch das objektive Belastungsempfinden beeinflussbar. Der konstante Abgleich mit Wattzahlen, Paces oder Herzfrequenzen kann das eigene Empfinden der Belastung beeinflussen und verfälschen.
Welche Rolle spielt das subjektiven Belastungsempfinden im Coaching?
Im Coaching ist die RPE ein wertvolles Werkzeug zur Bewertung der individuellen Trainingsbelastung, unabhängig von objektiven Leistungsdaten.
Viele Athletinnen und Athleten nutzen nach dem Training ihre Sportuhr oder die Garmin Connect App, um das subjektive Belastungsempfinden direkt anzugeben. Diese Information wird bei entsprechender Verknüpfung automatisch an Plattformen wie TrainingPeaks übertragen und dort gemeinsam mit Herzfrequenz, Pace, Wattwerten oder Dauer dokumentiert.
TrainingPeaks arbeitet dabei mit einer RPE-Skala von 0 bis 10, auf der die Athletin oder der Athlet angibt, wie anstrengend die Einheit empfunden wurde. Zusätzlich kann das allgemeine Gefühl zur Einheit ausgewählt werden, und zwar in fünf Stufen von „very weak“ bis „very strong“.
So kann der Coach nicht nur sehen, was geleistet wurde, sondern auch, wie es sich angefühlt hat. Das ist eine wichtige Grundlage, um die Trainingsintensität individuell anzupassen, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und langfristige Entwicklungen besser einordnen zu können. RPE wird so zur Verbindung zwischen Körpergefühl und Datenanalyse.

Intelligentes Training braucht mehr als Zahlen
Das subjektive Belastungsempfinden ist kein Ersatz für Technik, Diagnostik oder Trainingspläne. Jedoch es ist ein entscheidender Bestandteil kluger Trainingssteuerung. Es hilft dir, dein Training zu personalisieren, frühzeitig auf Warnsignale zu reagieren und langfristig gesünder und effizienter zu trainieren.
Manchmal weiß dein Körper eben doch besser, was gut für dich ist. Du musst nur lernen, ihm zuzuhören.
TIPP
Notiere nach jedem Training dein RPE auf einer Skala von 6 bis 20. Kombiniere das mit deinem Trainingsplan und analysiere, wie sich Belastung, Pace und Gefühl über Wochen verändern. Du wirst überrascht sein, wie viel du dadurch über dich lernst.
Quellen
Borg, G. A. (1982):
Psychophysical bases of perceived exertion. Medicine & Science in Sports & Exercise, 14(5), 377–381.